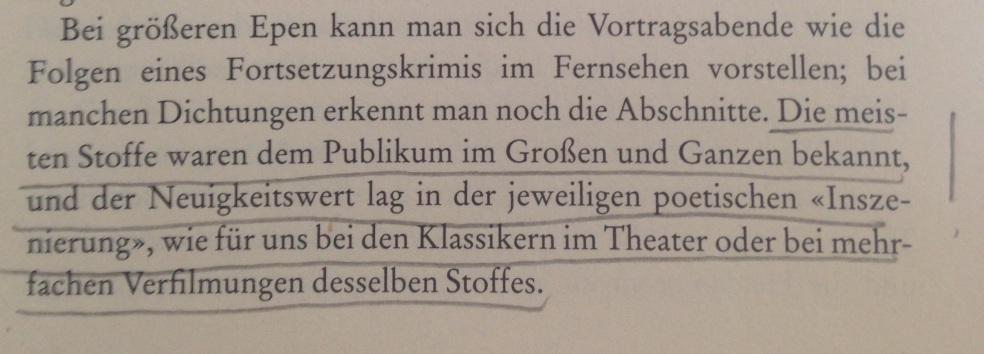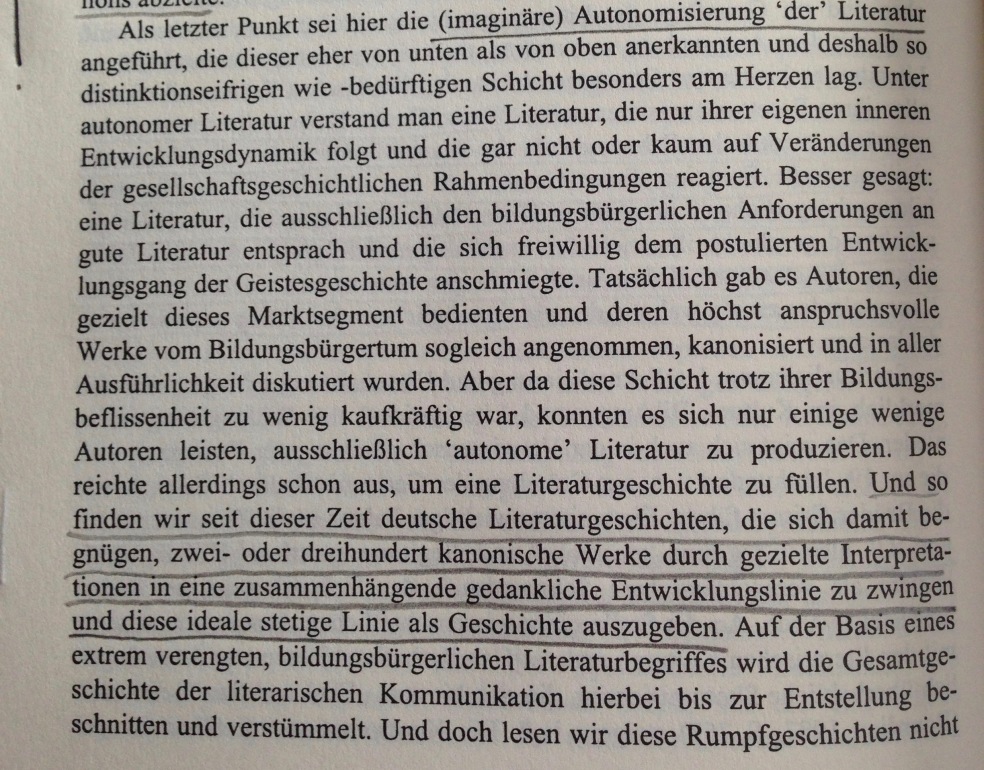Als ich überlegte, die Epoche in diesem Jahr zu geben, hatte ich zwei Einstiege für meine Arbeit: Zum einen war mir klar, dass ich erschreckend wenig über das Mittelalter weiß – ich musste mich also recht viel in die Grundlagen zu Literatur und Kultur einlesen. Wesentlich mehr wusste ich aber zu der Art von Erzählung zu sagen, die das Nibelungenlied ausmacht: eine so starke wie tragische weibliche Rächerfigur, die man spätestens seit Tarantino wieder im kulturellen Gedächtnis hat; ein Superheld, ein Machtpolitiker, ein schwacher König, die mit größtmöglicher Theatralik die Bedeutung von Macht, Reichtum und Gewalt vor sich hertragen und die schließlich an Zwängen ihrer Rollen zugrunde gehen. Von letzterem erzählt ein großer Teil der fantastischen Literatur zwischen dem Herrn der Ringe und Batman.
Fantastik
Der Teil meiner Epoche, der sich mit Literatur im engeren Sinne beschäftigt, hat dieses Fantastische in den Fokus genommen. Mein Ausgangspunkt: Ich vermute, alle SchülerInnen haben irgendwelche fantastische Geschichten, die sie geprägt haben/die sie echt mögen. Mein Ziel: Darüber nachdenken, was diese Erzählungen denn nun wie erzählen. Was „machen“ sie mit der Realität? Welche Funktion haben sie für ihre Leser? Und in der Gesellschaft? Was kann man an ihnen besser verstehen als an anderen Arten von Literatur, die den Ruf haben, „realistischer“ zu sein?
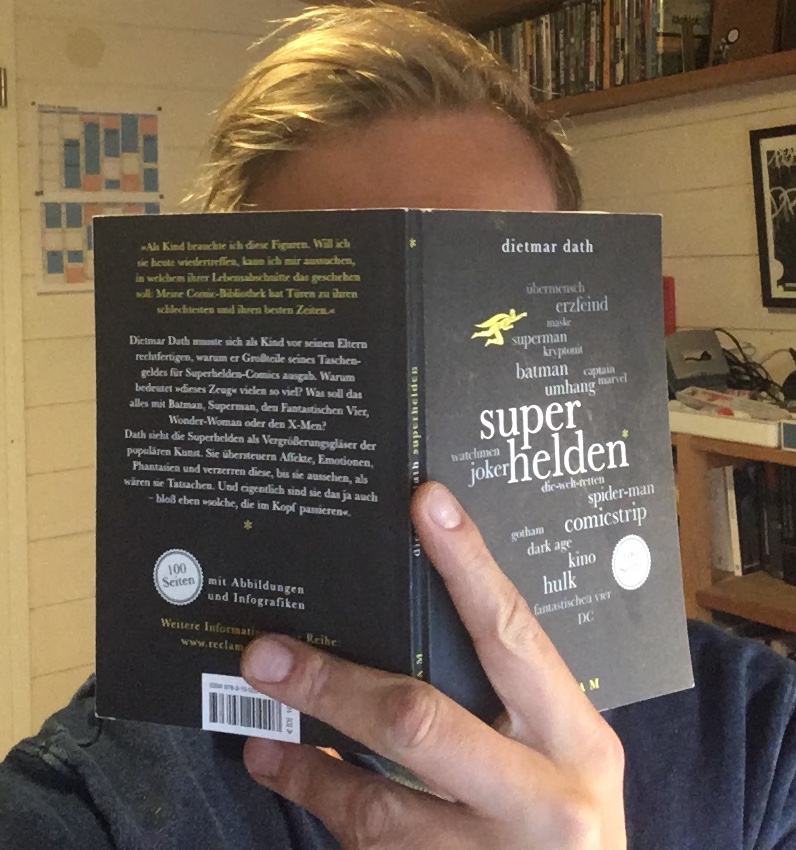
Nachdem ich das für mich geordnet hatte, fand ich Dietmar Daths „Superhelden“-Einführung und war extrem dankbar für den Band. Froh war ich, dass er mich in vielen Punkten bestärkte – froher noch, dass er mir Grundlagen, Fluchtlinien und historische Zusammenhänge aufzeigte. Gerade was die Fantastik angeht, ist man in Deutschland ja oft sehr prüde, tut solche Literatur meist schnell als Schmuddelkram ab (höchstens die Romantik lässt man vielleicht noch als „echte Literatur“ gelten).
Dath macht einen weiten Fantastik-Begriff auf. Für ihn ist „Fantastik schlechthin die Gesamtheit aller künstlerischen Techniken, die ihre jeweiligen Darstellungsmittel offensiv und konsequent dem Hauptzweck der Aufhebung des Unglaubens unterordnen.“ (Dath, „Superhelden“. S. 38)
Kurzum: Im Nibelungenlied wird ein großer Teil der Erzählung und der erzählerischen Techniken dafür eingesetzt, den Unglauben seiner Leserschaft aufzuheben, dass die Gewalt, der Reichtum aber auch die verfeinerten höfischen Sitten seiner Figuren gar nicht möglich sind. Das durchwegs adelige Personal hat einen übermenschlichen Status. Und den kann man sich (siehe gestern) aus dem Weltbild und der Gesellschaftsform des Mittelalters erklären – aber eben auch aus der Vorstellungswelt, die daraus in Erzählungen konstruiert wird:
Neben den realen Orten, den realistischen höfischen Ritualen, den historischen Figuren usw. stehen fantastische Orte, Charaktere und Handlungen, ohne dass der Text sie kategorisch trennte. Das schließt zum einen an Einsichten an, die wir mit der Ebstorfer Karte schon hatten – auf ihr sind z.B. das Paradies, die Menschenfresser und Braunschweig gleichermaßen eingetragen. Und das schließt zum anderen an alle fantastischen Erzählungen von Horror über Science-Fiction bis zu Ritter-und-Drachen-Fantasy und Batman-Heldentum an, die zu den größten Faszinationen der Kunst gehören.
Ein/ordnen
Ein Teil unserer Arbeit ist es mithin, zu verstehen, was solche Kunst kann. Und warum man sie mit guten Gründen (und gegen schlechte) sehr ernst nehmen sollte. Dazu noch einmal Dietmar Dath:
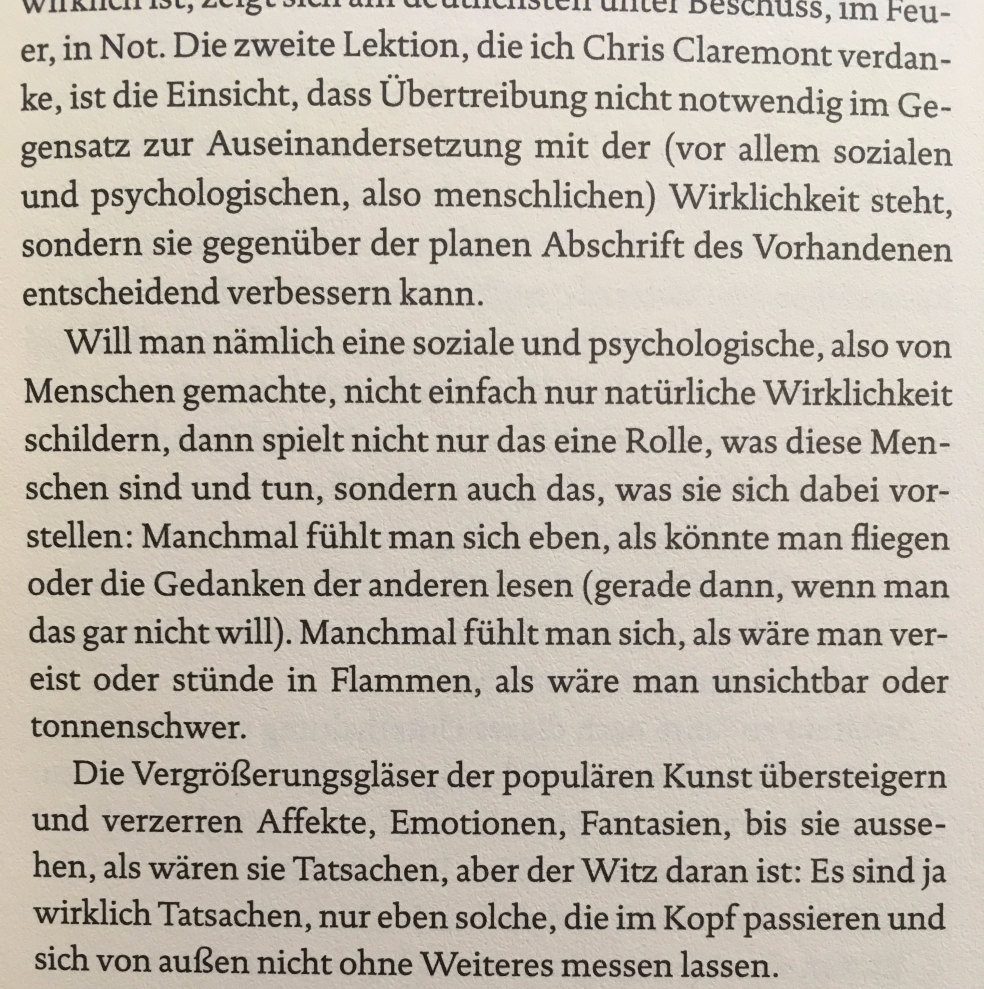
Eine wichtige Unterrichts-Frage ist daher auch, ob die Leser/Hörer im Mittelalter wohl dümmer als wir waren: Haben die das geglaubt, was da über Siegfried und Hagen steht, die 1000e Gegner problemlos in einem Blutbad versinken lassen?
Zum einen machen wir uns mit diesem Gedanken klar, dass zur Realität eben auch Perspektiven, Gefühle, Wünsche, Begierden gehören. Und dass diese Teile der Realität auch im Zentrum eines Textes/Filmes stehen dürfen. Wenn man sich nur an den Fakten, Naturgesetzen, Äußerlichkeiten festhielte (was ja gemeinhin als „realistisch“ empfunden wird), fehlte doch auch etwas – und würde doch auch ein Teil der Welt übermäßig betont. Das Nibelungenlied (mithin alle Spielarten der Fantastik) ist also nicht per se „unrealistisch“, „kindisch“ oder „dumm“. Siegfrieds Blutbäder stehen auch für das Gefühl ein, was einen Helden ausmacht – wie unverwundbar man sich an seinem besten Tag fühlt.
Zum anderen überlegen wir, welche Funktionen solches Erzählen hat. Beim Nibelungenlied etwa, dass es sich an eine bestimmte Leser-/Hörerschaft einer bestimmten Zeit richtet. Wer wird hier also wie dargestellt – und an wen richtet sich diese Erzählung? Sollen die Eliten idealisiert werden? Soll ihnen ein Spiegel vorgehalten werden? Soll man sich wünschen, ein Held zu sein? Und wenn ja, wer ist dann „man“ und welche Art von „Held“ ist denn wirklich wünschenswert? Warum stirbt die alte Version „Held“ am Ende des ersten Teils? Warum stirbt die neue Version auch?
Zum Beispiel: Frauenfiguren
Viele Figuren bieten sich an, um diese Spannungen zu vertiefen. Etwa Prünhilt, die von Siegfried beispielhaft brutal dafür abgestraft wird, dass sie anderen Frauen ein schlechtes Vorbild sein könnte, wenn sie sich gegen den Beischlaf mit Gunter wehren würde. Eine üble Vergewaltigungsszene, die im Text fast schon als Slapstick daherkommt und die moralisch abgesichert wird, dadurch dass es gerade Siegfried, der strahlende Held ist, der hier zum Vergewaltiger und Vorbild aller Männer gemacht wird. Die Botschaft des Textes ist klar: Frauen wie Prünhilt werden mit allen Mitteln (und mit Recht) in die Schranken verwiesen.
Ähnlich auch Kriemhild, mit der der Text beginnt, die für uns als vielschichtige, gebrochene Figur interessant wird, die für ihre Treue und Liebe aber zuletzt brutalst ermordet wird – nicht zuletzt weil sie als Frau nicht dazu berechtigt ist, den Tod tapferer und ehrenhafter Ritter wie Hagen zu fordern.
Das kann man zum einen aus dem Ehr-Begriff des Mittelalters erklären, zum anderen aus der Idee von Minne als idealisierter Liebe, zuletzt aus der Geschlechterordnung, wie sie der Text erzählt. Es gehört eben zur Wirklichkeit des Textes, dass diese Frauenfiguren zwar stark und selbstbewusst erscheinen – dafür aber abgestraft werden. LeserInnen konnten und sollten daraus etwas lernen.
Auch hier erkennen wir idealisierte Figuren, an denen bestimmte Eigenschaften übermäßig betont werden: Sie erscheinen uns in ihrem Verhalten und ihren Fähigkeiten unrealistisch, fantastisch. Prünhilt ist eine Amazone, die ihre Superkräfte erst durch die Vergewaltigung verliert. Kriemhilt ist eine auserwählte und übermenschlich schöne Prinzessin mit seherischen Fähigkeiten, die 13 Jahre lang an einem Racheplan arbeitet. Dennoch haben sie einen Bezug zur Realität des Mittelalters: Sie vermitteln reale Gefühle, Werte, Erfahrungen. Sie vermitteln aber auch ein Bild davon, was/wie Frauen und Männer sein sollten – und was/wie nicht.
Das zu klären und dann zwischen unserer Lesweise als Menschen des 21ten Jahrhunderts und der Perspektive des Mittelalters zu unterscheiden, hilft, die „Fremdheit“ des Textes ein bisschen besser zu verstehen. Warum wir Kriemhilts Liebe vielleicht gut nachvollziehen können, sie im Mittelalter aber als beispielhaft schreckliche Figur galt. Warum dieser Text eine Welt erzählt, die nicht die „Realität“ ist, aber dennoch etwas sehr reales vorbringt.
Ausschnitt: ein paar Arbeitsweisen
Neben einer Charakterisierung der Figuren und einer Diskussion des Handlungsverlaufs, der etwa die Vergewaltigungsszene umgibt, habe ich z.B. mit Materialien zum Minne-Begriff gearbeitet. Die SchülerInnen sollten u.A. eine eigene (besser verständliche) Version des Wikipedia-Artikels herstellen und mit Beispielen aus dem Nibelungenlied unterfüttern.
In Gruppenarbeiten konnte man sich für Themen (Weiblichkeit, Männlichkeit, Reisen, Liebe, etc.) entscheiden und dazu eine Frage bearbeiten: Weiblichkeit heute, Weiblichkeit im Nibelungenlied, Experteninterview Weiblichkeit, etc.
Eine Klausur-Variante bestand darin, dass jede/r sich eine der Figuren Siegfried, Hagen, Kriemhild aussuchen konnte – und diskutieren sollte, warum diese als Held/in taugte und taugt. Argumente dafür/dagegen sollten aus dem Text und unserer Arbeit zum Mittelalter genommen werden.